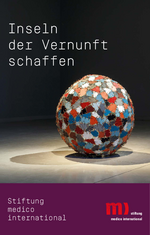Neun von vielen
Warum sich Menschen für die Stiftung engagieren
Nachhaltige Veränderungen brauchen Zeit und einen langen Atem. Vermögen in eine Stiftung einzubringen, ist ebenfalls ein auf Dauer angelegtes Engagement. Hier erklären medico-Stifter:innen ihre Motivation, sich auf diese Weise einzusetzen.
Dauerhaft Unabhängigkeit gewährleisten
Renate Zoller und Herbert Zipfel

Auf die Arbeit von medico international wurden Renate Zoller und Herbert Zipfel Ende der 1980er durch eine Anzeige in der Zeitschrift „konkret“ aufmerksam. Seitdem haben sie die Arbeit von medico verfolgt und regelmäßig finanziell unterstützt. „Der Ansatz von medico, die Verhältnisse zu verändern, die zu Not und Elend führen und nicht nur Nothilfe zu leisten, hat uns überzeugt“, erinnert er sich. Sie ergänzt: „Meistens haben wir ohne Zweckbindung gespendet, im Vertrauen darauf, dass medico durch den ständigen Austausch mit seinen Partnerorganisationen vor Ort bestens beurteilen kann, wo und wie die Mittel am sinnvollsten eingesetzt werden können.“ Als die beiden vor über 20 Jahren von der Idee erfuhren, die Arbeit von medico langfristig durch die Gründung einer Förderstiftung zu unterstützen und abzusichern, waren sie sofort bereit, sich einzubringen, die Idee in die Tat umzusetzen und einen entsprechenden finanziellen Beitrag zu leisten. „Jetzt, mehr als 20 Jahre nach unserer ersten Zustiftung, sind wir ein wenig stolz darauf, zum Erfolg der Stiftung beizutragen“, findet Renate Zoller. Schließlich habe diese seither rund 190 Projekte von medico international finanziell gefördert und gewährleistet dauerhaft die Unabhängigkeit von medico international. Herbert Zipfel betont: „Auch das großartige medico-Haus im Frankfurter Ostend wäre ohne die Stiftung nicht möglich gewesen.“
Worauf es ankommt
Antje Schwalbe-Kleinhuis und Uwe Schwalbe

Die Großeltern von Antje Schwalbe-Kleinhuis hatten Anfang des 20. Jahrhunderts eine Stiftung in Hamburg übernommen, deren Ziel es war, Kellnern auch außerhalb der Saison Beschäftigung und Unterkunft zu bieten. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die Eltern aus dem Kellnerheim ein Hotel. Antje Schwalbe-Kleinhuis erinnert sich gut, wie sie einmal Schiffbrüchige aufgenommen haben. Hierbei habe sie gelernt, worauf es im Leben ankommt: „Sich einsetzen für andere Menschen, sein Herz öffnen, tun, was man kann, seinen Teil beitragen.“ Genau das tat sie selbst viele Jahre später gemeinsam mit ihrem Mann Uwe: Mitte der 1990er-Jahre kaufte das Paar ein großes Haus auf St. Pauli. Nicht als Kapitalanlage, sondern um schönen und bezahlbaren Wohnraum zu erhalten. Das Haus ist inzwischen ein Vielfaches wer t, soll aber für die Mieter:innen dauerhaft erschwinglich bleiben. Im Vertrauen, dass medico dieses Ansinnen teilt, und aus Wertschätzung für die Arbeit von medico, haben die beiden vor vielen Jahren testamentarisch festgelegt, die Immobilie an medico zu vererben. Denn, so Antje Schwalbe-Kleinhuis: „Zu diesem Vermögen haben sehr viele Menschen beigetragen, deshalb soll es auch dauerhaft vielen Menschen wieder zugutekommen.“ Vor einigen Jahren ist Uwe Schwalbe gestorben. Auch in seinem Sinne hat sie die gemeinsame Entscheidung in Form einer Schenkung an die medico-Stiftung umgesetzt.
Ernsthaftigkeit und Tiefe
Andrea Kuhn

Seit nunmehr 18 Jahren konfrontiert sich Andrea Kuhn mitunter bis zum Anschlag mit dem weltweiten Unrecht. Als Leiterin des „Nuremberg International Human Rights Film Festival“ – ältestes und größtes Filmfestival zum Thema Menschenrechte in Deutschland – schaut sie im Sichtungsprozess jedes Mal mehrere Hundert Filme aus aller Welt. Oft ist das hart. Aber, so sagt sie: „Viele Filme erzählen eben auch von Solidarität, Hilfe und Ermächtigung, also vom Kampf um und für Menschenrechte.“ Über diese Arbeit ist die Filmwissenschaftlerin denn auch mit medico in Kontakt gekommen, schließlich ist medico, nicht zuletzt durch das Engagement der medico-Regionalgruppe Franken, auf dem Festival traditionell mit einer eigenen Veranstaltung vertreten. „Ich habe schon damals den scharfen, kritischen Blick von medico auf das Weltgeschehen kennen und schätzen gelernt“, erinnert sie sich. So sagte sie auch gerne zu, als sie 2013 gefragt wurde, ob sie bereit sei, Mitglied im Stiftungskuratorium zu werden. Heute, viele Kuratoriumssitzungen und Veranstaltungen in Frankfurt wie in Nürnberg später, kennt sie medico noch viel besser. Von dem Austausch, aber auch der Ernsthaftigkeit und Tiefe, mit der im Kuratorium diskutiert werde, profitiere sie sehr. Umgekehrt nutzt sie das Filmfestival, um medico-Perspektiven zur Diskussion zu stellen. Schnittstellen gibt es also viele, wechselseitige Anregungen obendrein. So ist es nicht verwunderlich, dass Andrea Kuhn nun auch als gewählte Vertreterin des Kuratoriums im Vorstand der Stiftung aktiv ist.
Ein politisches Zuhause
Andrea und Florian Weber

Ohne Menschen wie Andrea und Florian Weber wäre die Stiftung medico international vielleicht nie entstanden. Und sicher hätte sie sich nicht zu dem entwickelt, was sie heute ist. Sie Ärztin und Psychotherapeutin, er Psychologe und Psychotherapeut, beide früh politisch bewegt, als Paar irgendwann mit einem beträchtlichen Erbe im Rücken, waren immer schon bereit, solidarisch zu teilen. Warum sie sich ausgerechnet für die medico-Stiftung engagieren? „Bei der Entscheidung, Gründungsstifterin und -stifter zu werden, haben uns viele Fragen beschäftigt: Wie viel von der Hilfe kommt an? Beschränkt sie sich auf die Linderung von Not oder bezieht sie deren Hintergründe mit ein? Trägt sie zum Aufbau möglichst nachhaltiger Strukturen bei? Und kann sie der neoliberalen Globalisierungswüste wenigstens ein kleines Stück Grünland abtrotzen? medicos Grundidee hat uns sehr angesprochen: nämlich vor Ort bestehende Initiativen aufzugreifen und zu fördern“, erklärt Andrea Weber. Florian ergänzt: „Dass wir medico bis heute treu geblieben sind, liegt auch daran, dass wir nie das Gefühl hatten, wir geben Geld und damit hat es sich.“ Sie seien immer mit vorzüglichen Projektinformationen versorgt worden, Entscheidungsprozesse seien stets transparent gewesen. „Da war immer das Gefühl, bei medico ‚dabei zu sein‘. Gerade in diesen immer ungemütlicher werdenden Zeiten ist es ein saugutes Gefühl, für sich und sein Engagement ein so anheimelndes politisches Zuhause gefunden zu haben.“
Keine einfachen Wahrheiten
Ingrid und Theo von der Marwitz

Als die medico-Stiftung vor einiger Zeit zu einer Veranstaltung nach Frankfurt einlud, machten sich Ingrid und Theo von der Marwitz aus Bremen auf den Weg. „Es gefällt mir, dass die Stiftung ihren Förderern durch Einladungen zur gemeinsamen Diskussion etwas zurückgibt“, findet sie. Ihr Mann, der wie sie in Bremen psychoanalytisch tätig ist, schätzt zudem das Wie: „Viele Hilfsorganisationen glauben, dass Spender oder Stifter einfache Wahrheiten wollen, medico hingegen setzt auf einen informierten Unterstützerkreis und trägt auch zu seiner Informiertheit bei.“ Diesem Kreis gehört das Ehepaar aus Bremen schon lange an. So hat er medico bereits in den 1980er-Jahren in Nicaragua kennengelernt, wo er als Kinderarzt bei den Gesundheitsbrigaden aktiv war und medico eine tragende Rolle gespielt habe. Längst sind beide von der Arbeit der Frankfurter Organisation angetan. „Ich finde die partnerorientierte Hilfe sehr überzeugend, vor Ort lokale Initiativen zu fördern“, erklärt Ingrid von der Marwitz. Hinzu kommt der psychosoziale Förderschwerpunkt: „Psychosoziale Themen fallen oft hinten runter“, meint Theo von der Marwitz. „Deshalb freut es mich, dass die Stiftung hier auf langfristige Konzepte setzt.“ Das passt auch zu seinem gesellschaftspolitischen Engagement: Schon 1989 gründete er gemeinsam mit anderen „Refugio“, ein Zentrum, in dem er sich noch bis vor Kurzem aktiv um die psychosoziale und therapeutische Behandlung von Flüchtlingen und Folterüberlebenden gekümmert hat. Schnittstellen zu medico hat es da zuhauf gegeben.